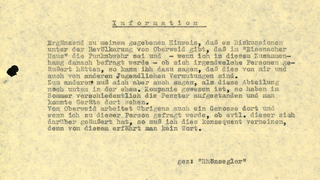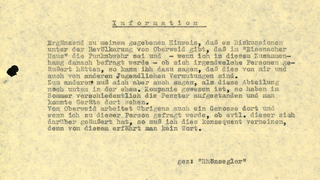
Blick in den Osten
Themenbeitrag über die Grenzinformationsstellen an der innerdeutschen Grenze.

Maximilian Schönherr und Sascha Münzel, Quelle: BArch
Entlang der tödlich gesicherten Grenze durch das geteilte Deutschland gab es seit Mitte der 1960er Jahre auf Westseite "Grenzinformationsstellen". Von dort aus konnte man in die DDR schauen und sich über das Grenzregime informieren. Wie die Stasi diese "Feindobjekte", zum Beispiel einen Aussichtsturm in Oberfranken, in den Blick nahm, erzählt Sascha Münzel, Historiker und Mitarbeiter der Außenstelle Suhl des Stasi-Unterlagen-Archivs im Bundesarchiv. Dort lagern knapp vier Kilometer der Stasi-Akten des Archivs über die Region Suhl.
[Jingle]
Sprecherin: "111 Kilometer Akten - [Ausschnitt einer Rede von Erich Mielke: ...ist für die Interessen der Arbeiterklasse!] - der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs".
Maximilian Schönherr: Ich begrüße Sie zur Folge 54. Ihre Podcast-Gastgeber: Das bin ich, Maximilian Schönherr, Journalist, Wikipedia-Autor und intensiver Nutzer von Archiven, und das ist Dagmar Hovestädt, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Wissen im Stasi- Unterlagen-Archiv im Bundesarchiv.
Dagmar Hovestädt: Heute begeben wir uns ins südwestliche Thüringen, nach Suhl. Zu DDR-Zeiten war Suhl eine Bezirkshauptstadt und damit auch Sitz einer Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit. Suhl war der kleinste Bezirk der DDR und Suhl als Hauptstadt war - ohne den Suhlern damit zu nahe treten zu wollen - eine Art Verlegenheitslösung. Denn alle anderen, damals auch größeren Städte in der Region - also Meiningen, Ilmenau oder Sonneberg - waren aus topographischen Gründen nicht geeignet. Nicht zuletzt, weil zwei der Städte zu nahe an der innerdeutschen Grenze lagen. Aber diese lange Grenze zu Bayern, also genauer gesagt Franken, und auch Hessen war ein intensives Arbeitsgebiet der Stasi im Bezirk Suhl. Und ergo finden sich in unserer Außenstelle in Suhl sehr viele Geschichten, die mit dieser Grenznähe zu tun haben.
Diese zweite Episode aus Suhl ist bei deinem Besuch dort im November 2021 entstanden. Hattest du dir die Außenstelle dort so vorgestellt?
Maximilian Schönherr: Nee! Ich hatte sie mir gar nicht vorgestellt. Eure Außenstelle liegt in einem Plattenbau am Stadtrand, auf dem Friedberg. Ich fand es eigentlich gar nicht so bergig dort im Unterschied zu anderen Stadtteilen. Und dort findet man nicht ganz so schnell hin, weil man nicht einfach in der Stadtmitte aus drüber stolpert. Jedenfalls circa 15 Minuten zu Fuß - wir sind mit dem Auto gefahren - vom Stadtzentrum entfernt. Sascha Münzel, der mich im Auto mitgenommen hat und rumgeführt hat, dein Kollege dort, hat mir erklärt, dass das früher einmal eine Offiziershochschule der DDR-Grenztruppen war und ihr seit 1992 dort die regional angefallenen Stasi-Unterlagen verwahrt.Es ist einer der Standorte, die keinen Bezug zur historischen Bezirksverwaltung der Stasi haben, sondern ein sehr funktionales Gebäude mit Büros und Archivräumen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Antragstellerinnen und Antragsteller da ruhig und sachlich ihre Akten einsehen können.Ich selbst hatte ein erhebliches Privileg, nämlich mit Herrn Münzel ging ich ins eigentliche Archiv und zwar unter Aufsicht. Da ist immer jemand dabei, wenn so etwas mal passiert. Ich darf natürlich nicht einfach mal da reinstolpern, mir eine Akte aus dem Schrank ziehen. Da wurde sehr aufgepasst! Mir war wichtig, für diesen Podcast ein ordentliches Foto aufzunehmen. Das war der Nebengrund, warum ich dort war. [schmunzelt] Ich guck mir einfach gern auch Aktenschränke an.
Dagmar Hovestädt:[lacht leicht] Das ist dann auch gut zu hören, weil das ja letztendlich ein praktizierter Datenschutz ist. Denn in vielen dieser Unterlagen, nicht gerade in jeder die man in so einem größeren Konglomerat aus dem Regal ziehen könnte, sind Daten, die wird zu schützen haben. Deswegen ist das bei uns nicht ganz so einfach, mal eben ins Regal zu greifen.In Suhl liegen knapp 3,8 Kilometer Unterlagen aus den acht ehemaligen Kreisen im Bezirk Suhl sowie der Bezirksverwaltung selbst. Heute sind knapp 40 Mitarbeitende mit der Verwahrung, Erschließung und der Ermöglichung von Akteneinsichten dort beschäftigt. Wenn es die Lage zulässt - also nicht Corona-mäßig begrenzt ist - kann man dort an Archivführungen teilnehmen, seine Akten im Lesesaal lesen oder auch den Vorträgen von zum Beispiel Sascha Münzel zuhören. Habt ihr eigentlich auch über das MfS in Suhl gesprochen?
Maximilian Schönherr: Das Ministerium für Staatssicherheit spielt immer bei solchen Treffen hinein. Das ist klar. Im gesamten Bezirk Suhl gab es über 1.700 Mitarbeitende, die Bezirksverwaltung allein hatte ungefähr 1.400 Mitarbeitende, in den acht Kreisdienststellen war es insgesamt rund 340.Suhl war dem MfS gegen Ende der DDR ein Dorn im Auge, weil viele Bürger und Bürgerinnen in der Friedlichen Revolution aktiv waren und eine der größten Demonstrationen vor dem Mauerfall organisierten. Auch bei den Besetzungen der Stasi-Dienststellen waren die Suhler am ersten Tag so einer Besetzung, dem 4. Dezember, neben Erfurt, Leipzig und Rostock dabei.Schon im ersten Podcast mit Sascha Münzel – da ging es um Weihnachten und Christbaumkugeln und die Stasi – klang ein Suizid im Januar 1990 an. Der letzte Chef der BV (Bezirksverwaltung), Gerhard Lange, hatte von 1981 bis zum Schluss, also fast zehn Jahre, die Stasi in Suhl geleitet und sich, er war damals 55 Jahre alt, erschossen. Er hat also das Ende nicht wirklich verkraftet. Es gab sicherlich nicht viele Stasi-Funktionäre, die sich "die Kugel gaben"?
Dagmar Hovestädt: Ich würde sagen, es war nicht unbedingt ein Massenphänomen. Es ist ja eh eine etwas anstrengende Situation. Aber Lange war tatsächlich nicht der einzige im MfS. Auch der BV-Chef von Dresden, Horst Böhm, hat sich in der Zeit, im Februar 1990 und damit ein Monat oder wenige Wochen später, umgebracht. Und Peter Koch, der Chef der Bezirksverwaltung Neubrandenburg, der saß wegen "Veruntreuung sozialistischen Eigentums" im Mai 1990 in Haft und brachte sich dort ebenfalls um. Tragisch und vielleicht auch ein Hinweis darauf, wie stark sich diese Männer im Apparat einer Weltsicht verschrieben hatten und mit so einer neuen Realität einfach nicht mehr klarkamen.Jetzt sind wir aber etwas abgekommen von der eigentlichen Geschichte aus Suhl, die nun aber mit der Grenze zu tun hat. Damit hast du ja sogar auch eine kleine biografische Verbindung, oder?
Maximilian Schönherr: Eigentlich eine große. Meine Eltern waren Lehrer. Wir zogen ein paar Mal um, weil die Lehrer immer versetzt werden, und ungefähr fünf Jahre wohnten wir in Neustadt bei Coburg, unmittelbar an der DDR-Grenze. Unmittelbar heißt: Die Stadt endete im Norden tatsächlich mit Stacheldraht und Warnschildern, dass bei Verletzung der Grenze von der Schusswaffe Gebrauch gemacht würde. Sonntags - ich fand die Ausflüge persönlich immer ganz elend als kleiner Junge - gingen wir entweder zur Grenze, wie langweilig, und zurück, oder auf den immerhin 500 Meter hohen Muppberg, von dem aus wir auf Neustadt und Sonneberg runter gucken konnten. Neustadt war eine relativ kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern, und Sonneberg viel größer mit ungefähr doppelt so vielen Einwohnern. Meine Eltern sagten aber dazu nicht: Sonneberg in Thüringen, sondern nur "Ostzone". Es war für uns einfach nicht betretbares und doch so nahes Niemandsland.Wir hatten Freunde in einem anderen grenznahen Ort, nämlich Bad Königshofen. Neustadt liegt in Oberfranken, Königshofen ziemlich weit weg in Unterfranken. Und da sehe ich auf der Webseite des Stasi-Unterlagen-Archivs eine Bilderstrecke, die sich um einen Aussichtsturm bei Bad Königshofen dreht. Klang für mich wie ein Heimspiel! [schmunzelt] Ich war sicherlich mit meinen Eltern und meinem Bruder auf diesem Turm gewesen, war aber zu klein, um mich zu erinnern. Es wäre eh nichts besonderes gewesen, weil wir die DDR eben dauernd in der Nähe hatten. Außerdem war unser Bezug zur DDR durchaus innig, weil einige Verwandte tief im Inneren der DDR lebten und wir sie regelmäßig, das heißt ein Mal pro Jahr und dann umständlich mit dem Zug, besuchten.Jedenfalls wollte ich mehr über diesen Turm bei Bad Königshofen wissen, der sich – was ich vorher noch nie gehört hatte – Grenzinformationsstelle nannte. Und der Autor der Story über die Grenzinformationsstellen auf eurer Webseite ist eben dieser Kollege von Dir, und der war mir einen Besuch mit dem Regionalexpress wert.
Dagmar Hovestädt: Hier kommt also dein Gespräch mit meinem Kollegen, dem Historiker Sascha Münzel aus der Außenstelle Suhl. Ihr legt gleich los mit einem Foto aus dem Archiv zu diesen Grenzinformationsstellen.
[Jingle]
Maximilian Schönherr: Wir sehen jetzt ein Foto. Das ist aufgenommen aus, ich würde mal sagen, gefühlt 30 Meter Höhe. Also ist ein Flugzeug da geflogen.
Sascha Münzel: Eher ein Hubschrauber. Also das Foto zeigt den "Bayernturm" oder auch "Bayern Landturm" genannt. Unten am Hang ist eine Ferienhaussiedlung zu sehen, links auf dem Bild eine Gastwirtschaft. Das Foto ist überliefert in Stasi-Unterlagen zum "Bayernturm" und wurde mutmaßlich angefertigt von den DDR-Grenztruppen im Rahmen eines Aufklärungsfluges.
Maximilian Schönherr: Dieser Flug ist, jetzt direkt an diesem Bild zu sehen, über DDR-Gebiet.
Sascha Münzel: Genau.
Maximilian Schönherr: Der kuckt in den Westen rüber.
Sascha Münzel: Genau, der kuckt in den Westen rüber mit einer relativ gut auflösenden Kamera, mit einem guten Objektiv aufgenommen und das wurde dann im Rahmen, wie es ja beim MfS hieß, des politisch-operativen Zusammenwirkens dem MfS zur Verfügung gestellt.
Maximilian Schönherr: Wir sprechen von einem Ereignis von 1966.
Sascha Münzel: Die Einweihung dieses Turmes war im Juni, also im Sommer 1966, wurde mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich dort eingefunden hatten, begangen. Auch Prominente aus Lokalpolitik, Regionalpolitik und auch von der bayrischen Staatsregierung fanden sich damals in der unterfränkischen Provinz ein, um diesen "Bayernturm", der ja als weithin sichtbares Symbol in den Osten wirken sollte, einzuweihen.
Maximilian Schönherr: Sollte er das? Oder sollte er einfach Westbürgern, die von Bad Königshofen da eben mal rüber fuhren an die Grenze einen tiefen Einblick in die DDR-Grenzanlagen geben? Die DDR sieht es als Symbol der antisozialistischen Propaganda, aber der Westen hat vielleicht nur gesagt "Schöne hohe Stelle, da können wir mal alles überblicken und viele interessierte Westbürger dahinführen."
Sascha Münzel: Also natürlich wurde dieser Turm von der DDR-Propaganda von seinem Bestehen '66 bis zuletzt als "Revanchisten-Turm" bezeichnet. Dort, wo sich quasi die - mal salopp gesagt - alten Nazis aus der Bundesrepublik einfanden, um quasi in diesen neuen Staat, die DDR, herüberzuschauen, der ja wirklich nur ein paar hundert Meter Luftlinie weg lag, und die neuen Errungenschaften in diesem Staat quasi niederzumachen.Auf der anderen Seite: dieser "Bayernturm" sollte auch auf Seiten der Bundesrepublik als Touristenmagnet ziehen. Sie müssen sich vorstellen, diese damaligen Gebiete im sogenannten "Zonenrandgebiet", also so einem Gürtel von etwa 40 Kilometern, der sich von Ostsee, bei Lübeck, bis Hof und auch noch an der heutigen Tschechischen Republik her lang schlängelte.
Maximilian Schönherr: Nicht 40 Kilometer. 400, oder? Sie haben 40 Kilometer gesagt?
Sascha Münzel: Dieses "Zonenrandgebiet" war 40 Kilometer breit.
Maximilian Schönherr: Ach, breit!
Sascha Münzel: Breit, genau. Und da gab es eben spezielle Förderungen und es war ja auch relativ strukturschwach anhand dieser Grenzsituation. Und deswegen hat man dann auch diesen Turm dahin gebaut, der aber auch so eine symbolische Strahlkraft in de DDR hinein haben sollte. Und natürlich benutzten auch angehörige der bayrischen Grenzpolizei, des Grenzzolldienstes und des Bundesgrenzschutzes auch mal die Aussichtsplattform um in den Osten zu schauen.
Maximilian Schönherr: Waren Sie mal da?
Sascha Münzel: Leider nein. Ich kenne quasi dieses Objekt sehr gut, aber nur anhand der Akten, ja. Das ist ganz kurios. Es ist ja auch nicht weit von hier weg. Ich hatte es mal vor, hinzufahren , was ich auf jeden Fall noch machen werde.
Maximilian Schönherr: Weil den Turm gibt es ja noch.
Sascha Münzel: Den Turm gibt es noch, hat leider etwas von seiner Strahlkraft verloren. Weil natürlich dieser Turm jetzt nicht mehr an irgendeiner hoch gesicherten Grenze liegt sondern zentral in Deutschland an der bayrisch-thüringischen Landesgrenze. Er hat dann natürlich auch ein bisschen - oder, was heißt ein bisschen - er hat an Besuchern eingebüßt. Also vor 1990 kamen dort jährlich tausende von Menschen hin. Heute sind es vielleicht noch ein paar hundert. Und er ist natürlich in die Jahre gekommen.
Maximilian Schönherr: So ein Betonturm, ziemlich schlank, da fuhr wahrscheinlich ein Aufzug hoch, und dann oben wird es richtig eine breite Ausblicksplattform und das Ganze befindet sich auf einem Büchelberg. Das war ein Ost-West-Berg, denke ich mal?
Sascha Münzel: Also konkret war das eine Stahlkonstruktion, die quasi mit Wellblech ummantelt wurde und oben gab es so ein Achteck für die Besucherinnen und Besucher mit quasi so einer Rundumsicht. Oben in der Plattform fand sich ein großes Model, wo die Grenzanlagen und auch die gegenüberliegenden Ortschaften im damaligen DDR-Bezirk Suhl abgelichtet waren. Da gab es zum Beispiel Knöpfe, die konnte man drücken. Wenn man zum Beispiel auf den roten Knopf gedrückt hat, gingen alle Lichter an wo Grenzkompanien waren und so was, ja.
Maximilian Schönherr: Also ich bin im Zonenrandgebiet aufgewachsen und das war ein typischer Sonntagsspaziergang, dass wir zur Grenze gingen. Bei Neustadt, bei Coburg, Richtung Sonneberg - auf der anderen Seite. Deswegen ist mir dieses Bild hier zum Beispiel, was Sie auch auf der Webseite zeigen, wo Alfred Dregger, Innenminister und ein sehr rechter Politiker, dann Leuten diese Grenzanlage zeigt. Das ist jetzt nicht direkt bei dem Turm gewesen, dieses Foto, aber ein typisches Bild für das Zonenrandgebiet. Es gab ein Interesse von westlicher Seite aus, diese Grenze zu besuchen. Dachten ein paar Leute in der Stasi oder in der SED, das wird eine Raketenrampe?
Sascha Münzel: Im Rahmen eines Vortrages hatte ich dieses Thema, auf das wir jetzt ja auch kommen, dieser Grenzinformationsstellen vorgestellt. Die Grenzinformationsstellen waren quasi Einrichtungen, die an der innerdeutschen Grenze auf Bundesgebiet lagen und wo, allgemein gesagt, über das Grenzregime und über die DDR aufgeklärt wird. Und zu diesen Grenzinformationsstellen gehörten teilweise Volkshochschulen; Aussichtsplattformen, Beobachtungstürme, wie auch der "Bayernturm" einer war. Die erste, die eingeweiht wurde, dass war auch parallel zum "Bayernturm", die befanden sich auch in Unterfranken, im heutigen Landkreis Röhn-Grabfeld, in Breitensee und Dürrenried.
Maximilian Schönherr: Auch ein Turm?
Sascha Münzel: Nee, relativ unscheinbare Häuser, wo quasi zwei, drei Räume benutzt wurden mit Ausstellungen, mit Infotafeln, mal mit einer Puppe, die bekleidet war mit Uniformen der Grenztruppen; wo quasi aktiv über das Grenzregime, den Aufbau der Grenzanlagen über die Geschichte der innerdeutschen Teilung aufgeklärt wurde. Das sind so grob gesagt diese Grenzinformationsstellen. Wenn man in dieses Zonenrandgebiet fuhr, dann fuhr man ja nicht einfach irgendwo an die Grenze und hat sich da was angekuckt sondern meistens waren diese Besuche so organisiert, dass man sich eine Ausstellung, einen Kurzfilm ansah in so einer Grenzinformationsstelle und dann noch ein paar Kilometer an die innerdeutsche Grenze fuhr. Und dort fanden dann meistens Grenzeinweisungen statt mit Angehörigen des BGS, der bayrischen Grenzpolizei oder des Grenzzolldienstes, die quasi Anmerkungen machten zum Aufbau der Grenzanlagen oder auch zu Ortschaften, die ja nur einen Steinwurf oder ein bisschen weiter als einen Steinwurf weg lagen.
Maximilian Schönherr: Raketenabschussrampe?
Sascha Münzel: Raketenabschussrampe, danke für den Hinweis. Diesen Hinweis hatte ich bekommen von einem Besucher.
Maximilian Schönherr: Einen Ihrer Vorträge?
Sascha Münzel: Genau und der hatte gesagt, dass man aus dem Osten relativ gut, also in der zweiten Hälfte der '60er Jahre diese Bauarbeiten von diesem Stahlgerüst von diesem "Bayernturm" sehen konnte und das man eben auf Ostseite gedacht hatte, dort wird irgendeine Raketenabschussrampe gebaut, irgend so ein Raketensilo. War aber falsch, war halt nur dieser - laut Ost-Propaganda - "Revanchisten-Turm".
Maximilian Schönherr: Was interessierte die Stasi an diesem Projekt?
Sascha Münzel: Weil diese Grenzinformationsstellen in den Augen der SED die DDR in Frage stellten. Also dort wurde quasi kommuniziert, dass die innerdeutsche Grenze, dass die Teilung Deutschlands nur vorübergehend sei. Dass quasi das hehre Ziel der deutschen Einheit immer weiter verfolgt werden soll, dass Bundesbürger direkt aufgerufen wurden, Kontakte in die DDR herzustellen, Familienkontakte zu verstärken. Und dass quasi auch der DDR, wie es die DDR-Propaganda oder auch die SED sah, dass Recht abgesprochen wurde, ihre eigene Grenze, die innerdeutsche Grenze, so zu schützen, wie sie es für richtig hielt: nämlich mit Grenztruppen und Mienen und schweren Sicherungsanlagen.
Maximilian Schönherr: Also typische West-Ost-Propaganda, wie sie auch in West-Zeitungen zu lesen war?
Sascha Münzel: Definitiv.
Maximilian Schönherr: Aber was war das Interesse der Stasi an dem Turm?
Sascha Münzel: Zu sehen: Wer konnte da oben hoch und wer konnte da oben tief in den Bezirk Suhl reinschauen? Man konnte beispielsweise in eine Grenzkompanie relativ gut hineinschauen, dass hat man dann durch IM erfahren.
Maximilian Schönherr: Die IM, die in den Westen geschickt wurden, um in dem Turm mal von oben auf den Westen zu gucken?
Sascha Münzel: Korrekt. Und da hat man sich dann entschlossen, um diese Grenzkompanie herum Pappeln zu pflanzen, die relativ schnell wachsen, wo dann die Einsicht in die Grenzkompanie quasi so ein bisschen behindert werden sollte. Dann hatte die Stasi natürlich von der SED den Auftrag bekommen, die Arbeit dieser Grenzinformationsstellen in irgendeiner Art und Weise zu behindern und zu beeinträchtigen.
Maximilian Schönherr: Wie geht das?
Sascha Münzel: Das geht natürlich erst mal dahingehend, dass man versucht, die Leute zu personifizieren, die dort arbeiten, ja. Also wer macht beispielsweise so die Einweisungen an der Grenze? Wer - also das klingt jetzt lapidar - hat einen kleinen Imbissstand am "Bayernturm"? Wer macht die Seminare zur Geschichte der innerdeutschen Grenze?
Maximilian Schönherr: Gut, aber da kann ja die Stasi nichts dran machen. Also der Gaststättenbesitzer oder der, der diesen Vortrag hält dort oben auf dem Turm, ist ja ein Wessi. Und da hat die Stasi ja keinen Einfluss. Die wird den ja nicht kalt stellen.
Sascha Münzel: Also im Stasi-Unterlagen-Archiv Suhl liegen Akten, die quasi beleuchten, dass die Staatssicherheit zu den Grenzinformationsstellen, die jetzt quasi im Bereich der Bezirksverwaltung Suhl lagen, sogenannte "Feindobjektvorgänge" konzipiert hat. Unter Feinobjekt wurde quasi verstanden: alles, was sich gegen die DDR oder ihre Verbündeten richtet und natürlich fiel so eine Grenzinformationsstelle darunter. Und in dem größten Feinobjekt, das war der Feindobjektvorgang "Thüringenblick", war quasi die Grenzinformationsstellen Breitensee, die wir hier sehen, dann Dürrenried und der "Bayernturm" und auch die "Henneberger Warte" bei Bad Rodach drinnen.
Maximilian Schönherr: Ja, Breitensee: Wir sehen hier ein Haus und das ist offenbar direkt an der Grenze.
Sascha Münzel: Das ist ein paar hundert Meter von der innerdeutschen Grenze entfernt, ja.
Maximilian Schönherr: Also "Thüringer Einsicht" oder wie hieß das nochmal?
Sascha Münzel: "Thüringenblick".
Maximilian Schönherr: "Thüringenblick".
Sascha Münzel: "Thüringenblick".
Maximilian Schönherr: Das war also das Thema, so wurde das bei der Stasi geführt: "Wir müssen was gegen diesen 'Thüringenblick', den Einblick von Bayern nach Thüringen, tun."
Sascha Münzel: Genau. Also alle Bemühungen gegen die beiden Aussichtspunkte "Bayernturm" und "Henneberger Warte" und gegen die beiden Grenzinformationsstellen Breitensee und Dürrenried wurden quasi unter diesem Decknamen "Thüringenblick" quasi zusammengefasst, ja.
[Jingle]
Sprecher: Sie hören:
Sprecherin: "111 Kilometer Akten -
Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs."
[Jingle]
Maximilian Schönherr: Hatte die Stasi denn den Eindruck, dass sich da was zusammenbraut oder war es einfach eine große Indiskretion, zu tief in das Gelände reinzugucken, wogegen man nichts machen kann, außer Pappeln zu pflanzen. Warum machen die so einen Aufwand? In den Akten haben Sie ja ziemlich viel dazu gefunden.
Sascha Münzel: ja, definitiv. Na ja, warum machen die so einen Aufwand? Um quasi die Bundesrepublik oder diese Institution im Zonenrandgebiet dahingehend zu stören, dass diese Grenzinformationsstellen ihrer Aufgabe, nämlich die bundesdeutsche Öffentlichkeit zu informieren, nicht mehr nachkommen. Das kann man beispielsweise machen, indem man mal versucht, jemandem aus dem Umfeld dieser Grenzinformationsstellen als IM zu werben, ja?
Maximilian Schönherr: Ist das passiert?
Sascha Münzel: Es ist nie passiert. Also auch, um das jetzt schon mal vorweg zu nehmen: der Staatssicherheit ist es bei den Beispielen, die ich kenne, nie gelungen, im Umfeld dieser Grenzinformationsstellen in irgendeiner Art und Weise einen IM zu werben, der für sie hätte tätig werden können. Dieser Feindobjektvorgang "Thüringenblick" wurde auch ein paar Jahre später ergebnislos wieder eingestellt, weil die Sicht des Stasi-Offiziers, der diesen Vorgang leitete, das war nur die des Dokumentars. Also der hat gesammelt, gesammelt, gesammelt, vom Branchenbuch zum Telefonverzeichnis. Also der hatte sehr, sehr viel. Dort fielen ja auch Hotels hinein, wo quasi Schulklassen absteigen konnten oder wohnen konnten, wenn sie dort im Zonenrandgebiet waren. Aber die konnten so gut wie keinen Einfluss auf das Wirken dieser Grenzinformationsstellen nehmen.
Maximilian Schönherr: Wir haben hier eine Akte vor uns. "Eröffnungsbericht", das klingt nach einem Anfang."Objektakte.Zum Anlegen der Feindobjektakte "Thüringenblick".Es wird vorgeschlagen, die im westlichen Grenzvorfeld des Kreises Hildburghausen existierenden sogenannten Informationsstellen "Breitensee" und "Dürrenried", sowie den Aussichtsturm Sternberg-Zimmerau in einer Feindobjektakte zu bearbeiten."Damit fing das Ganze an, oder?
Sascha Münzel: Genau, damit fing es an. Wenn man den Vorgang vor sich hat, es geht los mit einem Inhaltsverzeichnis, mit weiteren Formblättern und dann konnte man quasi hier dieses erste Blatt, das wurde angelegt von der Kreisdienststelle Hildburghausen.
Maximilian Schönherr: Aber 1984, am 10. Juli.
Sascha Münzel: Genau.
Maximilian Schönherr:Da war der Turm ja schon längst in Betrieb.
Sascha Münzel: Da war der Turm schon längst im Betrieb.
Maximilian Schönherr: 20 Jahre!
Sascha Münzel: Genau.
Maximilian Schönherr: Da hat man erst angefangen, darüber nachzudenken?
Sascha Münzel: Da hat man versucht, das gebündelt erst mal zu machen. Vorher liefen natürlich schon mehrere Operative Personenkontrollen, aber da hat man sich 1984 entschlossen, koordiniert mehrere Objekte in einem Vorgang zu bearbeiten. Was natürlich nicht heißt, dass nicht schon kurz nach der Eröffnung des "Bayernturms" 1966 schon die ersten IM – und das können wir nachweisen – dorthin in den Landkreis nach Unterfranken entsandt wurden, die dann der Stasi explizit aufschreiben sollten: Wie sind diese Räume dort aufgebaut? Was kann man dort sehen? Was liegen dort für Broschüren aus? Und was wird dort eigentlich den Besucherinnen und Besuchern über dort kommuniziert? Also das darf nicht hinwegtäuschen, dass dort 1984 steht. Die Bearbeitung dieser Grenzinformationsstellen, dieses "Bayernturms", ging eigentlich los mit der Eröffnung dieser Einrichtungen.
Maximilian Schönherr: Weil Sie vorhin sagten, das hat man dann irgendwann ad acta gelegt.
Sascha Münzel: Ja.
Maximilian Schönherr: Da noch nicht, oder? Hier hat man noch, also '84, gesammelt, vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre und dann hat man gesagt "Wir können da nichts tun, es bleibt jetzt so."
Sascha Münzel: Genau. Wir sehen hier auch nochmal, das ist ja auch für den Historiker und den Archivar nochmal sehr schön zu sehen, mit den Randnotizen. Also so ein Eröffnungsbericht, das konnte jetzt nicht irgendein x-beliebiger operativer Mitarbeiter in einer Kreisdienststelle eröffnen. Das musste nämlich erst bestätigt werden von einem Stellvertreter Operativ, der das quasi absegnete und auch von einem Vorgesetzten in der Kreisdienststelle nochmal gegengelesen werden. Und dann ging der operative Mitarbeiter an seine "Arbeit" und es hieß wirklich erst mal: Welche Personen sind dort tätig? Und so ging der Herr, der vorgangsführende Mitarbeiter, hier auch vor.
Maximilian Schönherr: Kennen wir den? Den Storch, Oberst?
Sascha Münzel: Den Herrn Sturch kennen wir ganz gut. Der war viele Jahre Stellvertreter in der Bezirksverwaltung Suhl. Und den Herrn, der – ich glaube, es war ein Oberleutnant – diese Feindobjektakte "Thüringenblick" führte, den kenne ich jetzt nicht explizit. Aber den Herrn Sturch, den kenne ich schon.
Maximilian Schönherr: [brummt zustimmend] Ich habe, bevor wir zu trafen, meinen Vater gefragt. Der wollte wissen, wohin ich jetzt fahre und ich habe ihm gesagt, ich fahre nach Suhl und wir reden über einen Aussichtsturm, der über die Grenze der DDR gucken konnte. Und dann hat er sich daran erinnert, dass er zu DDR-Zeiten auf der Westseite in diesem Turm war. Mindestens ein oder zwei Mal. Er sagte, von gegenüber, also von DDR-Seite, strahlte [schmunzelt] die Gegenpropaganda auf diesen Turm hin und man hörte in guter Akustik von versteckten Lautsprechern: "Das ist eine ernstzunehmende Grenze", sagte eine Stimme gut verständlich für die Wessis, "und das ist keine Unterhaltungsvorstellung." Quasi: ihr macht hier Entertainment, kapitalistischen Propagandaquatsch draus, aber es ist eine ernstzunehmende Grenze – die BRD hat ja diese Grenze nie anerkannt – und außerdem gab es zwischendurch Musik, da konnte er sich auch noch ganz genau daran erinnern, "schwarz-braun ist die Haselnuss; schwarz-braun bin auch ich". Ein Traditional würde man sagen, ein altes Volksmundlied. Können Sie sich das erklären? Sie haben das ja nicht gefunden in den Akten.
Sascha Münzel: Das ist auch wirklich ganz interessant, für diese Hinweise ist der Historiker auch total dankbar. Also diese Anekdote habe ich so in den Akten nicht gefunden. Auch über diese "Ätherbeschallung" aus dem Osten versteckt, hab ich gar nichts gefunden. Auch nicht darüber, dass Parolen rübergerufen oder durchgesagt wurden und auch jetzt mit diesem Lied, das habe ich in den Akten nicht gefunden. Sehr interessant!
Maximilian Schönherr: Da können wir nur fantasieren. "Schwarz-braun ist die Haselnuss" was ja eigentlich auf ein Mädchen gerichtet und eigentlich ein Liebeslied ist, dass die DDR das einspielte wegen der schwarz-braunen bayrischen Regierung. Könnte sein, 'ne? Wir wissen es nicht.
Sascha Münzel: Könnte sein. Genau.
Maximilian Schönherr: Auf dem einen Foto sieht man, wie Alfred Dregger, Innenminister, ungefähr einen Meter auf DDR-Seite steht, um zu seiner Gruppe von jungen Leuten, die eindeutig einen Meter von ihm entfernt auf der Westseite stehen, spricht. War das gefährlich?
Sascha Münzel: Also gefährlich war es, denke ich, immer an der innerdeutschen Grenze damals.
Maximilian Schönherr: Nicht wegen Minen, bei einem Meter ist kein Minenproblem, denke ich mal.
Sascha Münzel: Ich glaube, für den Herrn Dregger, der damals auf diesem Bild in seiner Funktion als Vorsitzender des CDU-Landesverbandes bei einer Veranstaltung auf dem Siechenberg bei Philippsthal war - das war 1978 - hätte es sicherlich keinerlei Probleme gegeben. Vielleicht irgendeine Protestnote der DDR der BRD gegenüber. Vielleicht so was, ja. Aber das soll ja vielleicht auch nochmal dieses Foto, was ich wirklich sehr gut finde, die Unterschrift der Staatssicherheit ist auch "Grenzverletzung", zu verdeutlichen. Man kann auch diese Personengruppe auf dem Bild sehr gut sehen, weil ein paar zeigen mit dem Finger auf ihn und sagen ihm bestimmt gerade: "Herr Dregger, Sie haben gerade das Territorium der Bundesrepublik verlassen und stehen gerade in der DDR." Sie sehen auch seine Haltung, mit den verschränkten Armen, das er wohl auch sagt: "Das ist mir eigentlich egal. Ich stehe hier in Deutschland. Was wollen Sie denn?"
Maximilian Schönherr: Tolles Foto.
Sascha Münzel: Das ist wirklich ein tolles Foto, ja.
Maximilian Schönherr: Er steht auch ein bisschen niedriger, weil es auch schon leicht abschüssig ist.
Sascha Münzel: Es ist an der Werra, genau, an der Werrabrücke zwischen Vacha und Philippsthal und wurde am 17. Juni aufgenommen. Für die Staatssicherheit war ja der Zeitraum 15. bis 18. Juni ein Zeitraum von erhöhter Alarmbereitschaft, vor allem hier an der Grenze, in den Grenzregionen. Der Bezirk Suhl hat mit Abstand die längste Grenze von allen Bezirken gehabt, also es waren knapp 395 Kilometer. Da werden manche sagen: "Ja, aber was ist mit West-Berlin? Was ist mit so einem langen, geografisch großen Bezirk wie Magdeburg gewesen?". Also der Bezirk Magdeburg hatte "nur" 340 Kilometer Grenze. Die Grenze von Ost- zu West-Berlin war knapp etwas über 40 Kilometer. Und was sich da auch für interessante oder traurige Geschichten hier an dieser innerdeutschen Grenze abspielten. Teilweise auch kuriose Geschichten, wie jetzt dieser vermeintliche Grenzübertritt von Herrn Dregger und nicht nur dieser 17. Juni war für die Stasi immer so ein Alarmsignal, weil dort viele Veranstaltungen an der innerdeutschen Grenze, gerade auch auf erhöhten Plateaus stattfanden, wo man das auch aus dem Osten etwas sehen konnte. Auch der 13. Juni, also der Jahrestag des - 13. August, Verzeihung – Mauerbaus, da fanden auch immer Aktivitäten an der innerdeutschen Grenze statt. Das hat die Staatssicherheit auch alles mit vielen Diensteinheiten versucht zu überwachen. Unsere Akten hier in Suhl sind ja voll mit sehr traurigen Geschichten, aber auch mit kuriosen Geschichten. Also, dass ein junger Mann in Oberfranken mit seinem Auto abkommt in einer Kurve und überschlägt sich und landet in der DDR.
Maximilian Schönherr: Was ist mit dem passiert dann?
Sascha Münzel: Der hat sich nur leicht verletzt und konnte die paar Meter zurückkrabbeln. Aber das Auto blieb liegen, das war in der Nähe des Städtchens Mitwitz. Und jetzt ging natürlich die große Diplomatie los: Was passiert mit dem Auto? Und es durfte dann abgeschleppt werden. Oder ein anderer Fall, dass zwei kleine Kinder mit ihrem Schlitten im Landkreis Sonneberg im Winter unter der Grenze durchschlittern und sind auf einmal in Oberfranken. Und solche kuriosen Sachen.
Maximilian Schönherr: Kamen die zurück?
Sascha Münzel: Die kamen zurück, auch auf offiziellem Weg.
Maximilian Schönherr: Und wenn wir nochmal auf das Foto zurückkommen, das können Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch auf der Website finden, auf dem Dregger einen Meter auf dem DDR-Gebiet ist. Niemand von den vielleicht fünfzehn Personen guckt in die Kamera. Das sagt uns, wo die Kamera stand: nämlich in einem Busch oder so, ne?
Sascha Münzel: Da können Sie sich sicher sein. Das haben wir auch überliefert von einer anderen Veranstaltung, wo Helmut Kohl zu Gast war, dass schon die Tage vorher, wo aufgebaut wurde, vielleicht eine Bühne oder ein paar Imbissstände, das wurde schon von Grenzaufklärern, die in irgendeinem Busch lagen, mit den Kameras aufgenommen. Oder auch von MfS-Leuten, die dort an der Grenze waren, fotografisch dokumentiert. Es ist sehr davon auszugehen, dass das Bild mit einer MfS- oder Grenztruppendienstkamera geschossen wurde.
Maximilian Schönherr: Und warum sind außer Dregger und die Personen, die man nur von hinten sieht, die anderen Gesichter verpixelt?
Sascha Münzel: Im Rahmen des Stasi-Unterlagen-Gesetzes haben wir die Gesichter noch nachträglich anonymisiert.
Maximilian Schönherr: Um die Personen zu schützen.
Sascha Münzel: Genau.
Maximilian Schönherr: Also Suhl liegt ja, wenn man sich das mal anguckt, auch die heutige Thüringer-Bayern-Grenze anguckt, kann man sich diese lange Grenze gut vorstellen. Suhl oder Erfurt sind der Mittelpunkt von einem Kreis eigentlich, was sich da so da drum herumzieht. Ist in diesem Mittelgebirgsszenen - ich bin jetzt im Nebel hier durchgefahren, ich konnte nicht genau sehen, wie das ist - aber war diese Grenze wirklich rundum gesichert? Also gab es da keine Lücken? Das ist sehr unwegsames Gelände teilweise.
Sascha Münzel: Es ist ein Mittelgebirgsgelände, ja. Und die Grenze ist einen Teil Hessens und dann Unterfranken, Oberfranken und dann ging auch schon der Bezirk Gera los. Aber natürlich, solche Vorfälle wie auch mit dem Schlitten, wo die beiden Kinder - das war 1969 - mit dem Schlitten unter die Grenze durch sind, das zeigt ja auch, dass –
Maximilian Schönherr: Unter die Grenze heißt unter dem Stacheldraht.
Sascha Münzel: Genau. Das zeigt quasi, dass das damals noch nicht so pionier-technisch gesichert war, mit Schreckmetallzaun und wenn Sie da eine Schlucht hatten, irgendein Abwasserrohr, das bot natürlich die Gelegenheit, dort in den Westen abzuhauen. Das nutzten natürlich auch viele, obwohl, was heißt viele, das nutzten einige, um sich da noch in die Bundesrepublik abzusetzen. Wobei natürlich die vermeintliche Flucht der beiden Jungen auf ihrem Schlitten dahingehend endete, dass sie da auch wieder kurze Zeit später von ihren Eltern in die Arme geschlossen werden konnten.
Maximilian Schönherr: Was wurde aus dem Turm inzwischen?
Sascha Münzel: Mit der deutschen Wiedervereinigung fiel ja so ein bisschen die Funktion dieser Grenzinformationsstellen weg.
Maximilian Schönherr: Eigentlich völlig.
Sascha Münzel: Nicht völlig. Also einige wurden aufgelöst, einige arbeiten heute noch als Grenzmuseen, als Begegnungsstätten. 2020 entschloss sich dann die bayrische Staatsregierung den Turm zu generalsanieren. Als Denkmal, ja.
[Jingle]
Dagmar Hovestädt: Das war mein Kollege Sascha Münzel, Historiker und in der Außenstelle Suhl des Stasi-Unterlagen-Archivs im Bundesarchiv, unter anderem für die Vermittlung der Inhalte zuständig. Dabei stößt er immer wieder auf spannende und politische, regionale Stories aus dem Alltag des Grenzbezirks Suhl zu DDR-Zeiten.
Maximilian Schönherr: Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audio-Pool des Stasi-Unterlagen-Archivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
[schnelles Tonspulen]
Elke Steinbach: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Bisher waren die Tonbeispiele von guter bis sehr guter Qualität. Um zu demonstrieren, womit sich die Kolleginnen noch so befassen, gibt es heute vier Beispiele für schwierigen Fälle. Das sind vor allem Raum- und Tonüberwachungen, Gespräche während Mitfahrten in Fahrzeugen, konspirative Aufnahmen aller Art. Hinzu kommen Schichtablösungen und Verformungen des Bandmaterials, meist aus Altersgründen, sowie Überlagerungen, Bandecho und Übersteuerung.Bis 2008 haben wir die Inhalte am analogen Tonträger erschlossen. Das heißt ein zusammenfassender, möglichst kurzer, prägnanter Titel wird von uns gebildet und inhaltliche Schwerpunkte werden im sogenannten Enthält-Vermerk näher beschrieben oder aufgezählt. Das Abspielgerät und die Abhörsituation waren oft nicht optimal und manchmal half nur das Hören über Kopfhörer - stundenlang.Die Erschließung am Digitalisat ist jetzt einfacher. Neben der optischen Unterstützung durch die Anzeige der Hüllkurve stehen Filter, Entrauscher und andere Hilfsmittel zur Verfügung. So manches ist dadurch erst jetzt verständlich. Diese Hilfsmittel kommen an den Nutzungsdigitalisaten zum Einsatz, die Originale selbst werden damit nicht bearbeitet.Und noch eine Zahl: fast 24.000 Stunden Audio sind derzeit digitalisiert. Das heißt knapp 2 ¾ Jahre, 24 Stunden am Tag, würde es dauern, alles gehört zu haben.
[Archivton 1]
[anhaltendes Rauschen]
[Beschleunigungen und Schalten eines Autos, Gesprächsfetzen dahinter kaum wahrzunehmen]
[Archivton 2]
[durchgängiger Brummton, überlagernd][männliche Stimme 1]: [vermutlich: Die Kontrollen [unverständlich], Angeklagter. Wer ist denn von Ihnen beiden der "klügere" in unserem Fall? [unverständlich, überlagert]]
[Angeklagter:] [vermutlich: Kann ich von mir aus nich' feststellen, dit [das] müssen Sie mir sagen.]
[männliche Stimme 1:] Na, na! Angeklagter!
[Archivton 3]
[männliche Stimme 2]: Wesentliche Bedeutungen messen wir in unserer Tätigkeit der baulichen, technischen und nachrichtentechnischen Sicherheit bei. Gerade in der bauseitigen Ausgestaltung unserer Dienstobjekte offenbaren sich bezüglich der Normativforderung entsprechend der Anweisung 10/80 des Genossen Minister eine Reihe von Unzulänglichkeiten, über die wir nicht hinwegsehen können. Das beginnt beispielsweise bei der Gestaltung der Besucherzonen in den Dienstobjekten unserer [vermutlich: jetzt neu erbauten] Kreisdienststellen, diese Anforderungen nicht gewährleisten. Wir ordnen der Gestaltung der Einpflegung unserer Dienstobjekte, wenn sie auch hoch sei- - wenn sie auch hofseitig insgesamt den Anforderungen Rechnung tragen, haben wir doch in manchen Fragen den architektonischen – äh, äh – Forderungen, ja? Der Gestaltung der Forderungen der, der Städteplaner mehr Rechnung getragen als wie [vermutlich: schließlich und letzten Endes den] Forderungen zur Sicherung unserer Dienstobjekte.
[Archivton 4]
[hochfrequentes Piepsen]
[sehr starkes, andauerndes Rauschen mit rhythmischem Klicken]
[männliche Stimme] [unverständlich]
[weibliche Stimme] [vermutlich: Un' die zweite Kiste?]
[männliche Stimme 3:] In der Hoffnung, dass [unverständlich]
[weibliche Stimme:] Ja?
[männliche Stimme 3:] [vermutlich: Das is' das.] [schnauft ins Telefon]
[weibliche Stimme:] [vermutlich: Ja, im Unterschied, dass Sie sich] [unverständlich]
[männliche Stimme 3:] Mhm. Mhm.
[mehrfaches Piepsen]
[Freiton nach beendetem Telefongespräch]
[Pfeiftöne]
[schnelles Tonspulen]
[Jingle]
Sprecher: Sie hörten:
Sprecherin: "111 Kilometer Akten -
Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs."